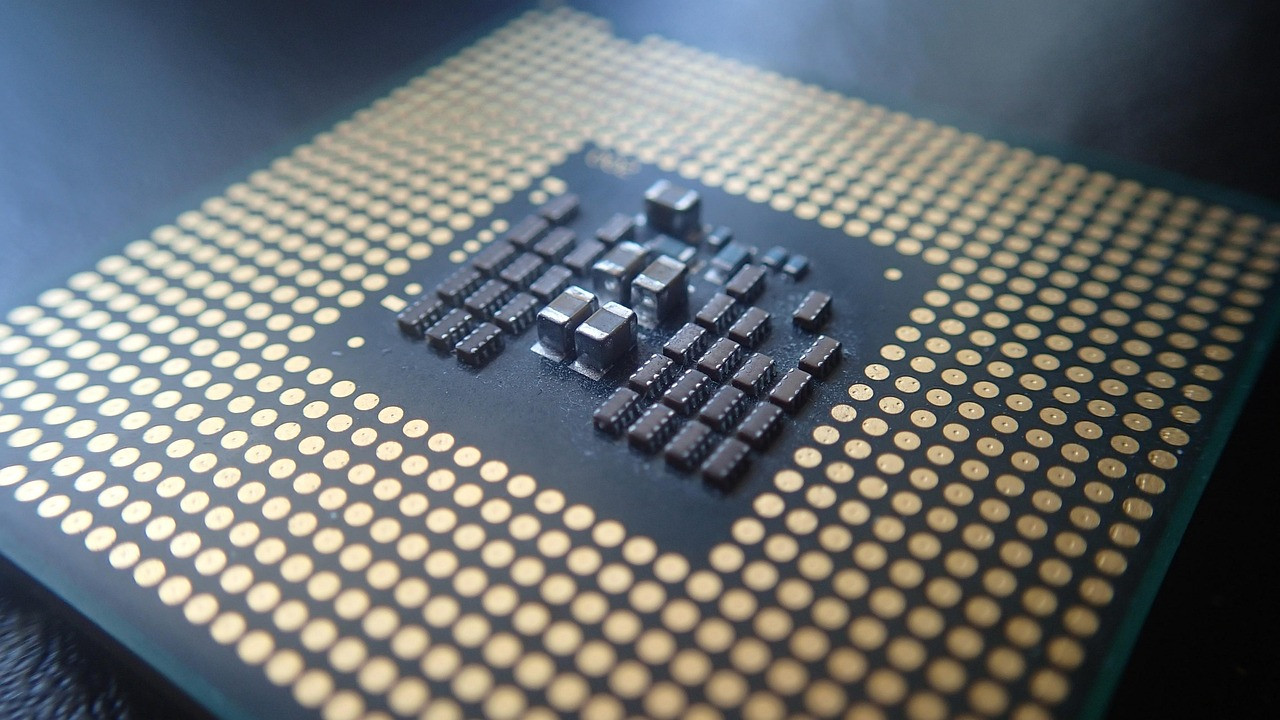Das Hauptziel der EU, ihren Anteil an der Produktion hochmoderner und nachhaltiger Mikrochips auf 20 Prozent zu steigern, wurde 2022 im Rahmen der „Digitalen Dekade“ formuliert. Doch der Bericht des Europäischen Rechnungshofs zeigt, dass dieses ambitionierte Ziel kaum realistisch ist. Um den Anteil bis 2030 zu erreichen, müsste die EU ihre Produktionskapazität vervierfachen – dies scheint derzeit unrealistisch.
Das Chip-Gesetz sieht vor, bis 2030 rund 86 Mrd. Euro in die europäische Mikrochipherstellung zu investieren. Doch die Europäische Kommission (KOM) trägt nur fünf Prozent (4,5 Mrd. Euro) dieser Summe bei. Der Rest muss von den Mitgliedstaaten und der Privatwirtschaft aufgebracht werden. Zum Vergleich: Die weltweit führenden Chip-Hersteller investierten in den letzten drei Jahren 405 Mrd. Euro. Dieser Finanzunterschied stellt eine erhebliche Hürde für das europäische Vorhaben dar.
Neben der unzureichenden Finanzierung gebe es mehrere andere Herausforderungen: hohe Energiekosten, die Abhängigkeit von Rohstoffimporten und geopolitische Spannungen. Diese Faktoren beeinflussten die Wettbewerbsfähigkeit der EU erheblich. Hinzu kämen der Fachkräftemangel und die Tatsache, dass die europäische Chip-Industrie von wenigen großen Unternehmen dominiert werde, deren Projekte große Summen erforderten und zu einer Konzentration der Mittel führten.
Trotz eines zu erwartenden Anstiegs der Produktionskapazität wird der Anteil der EU am globalen Mikrochips-Markt bis 2030 laut einer Prognose der KOM nur geringfügig steigen, von 9,8 Prozent im Jahr 2022 auf 11,7 Prozent. Das 20-Prozent-Ziel ist somit in weite Ferne gerückt. Bis September 2026 muss die KOM ihren ersten Zwischenbericht des Chip-Gesetzes vorlegen.
Die gesamte Pressemitteilung ist hier auffindbar. (LS/UV)