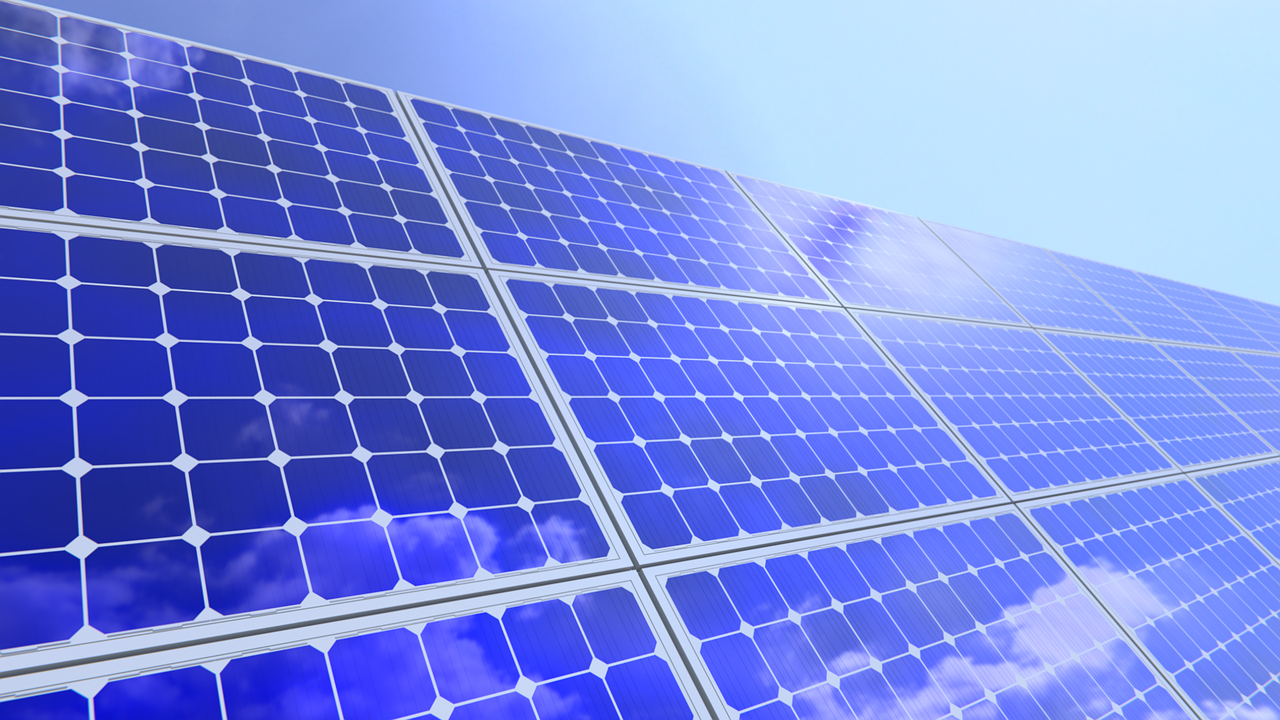Durch den von der Europäischen Kommission vorgestellten Gesetzesvorschlag „Net Zero Industry Act“ werden geeignete Voraussetzungen für solche Industriesektoren geschaffen, die für das Erreichen des Netto-Null-Ziels bis 2050 entscheidend sind. Zusammen mit einer Initiative zu kritischen Rohstoffen und der Reform des Strommarktdesigns sollen die Vorschläge zur Netto-Null-Industrie einen klaren Rahmen bieten, um die Abhängigkeit der EU von Importen zu verringern und die Widerstandsfähigkeit der europäischen grünen Industrie zu stärken.
Zentrales Element des Netto-Null-Industrie-Gesetzes ist der Status der “strategischen europäischen Klimaindustrieprojekte” (Net Zero Resilience Projects). Diese müssen Kriterien, wie zum Beispiel die Reduzierung von Abhängigkeiten von Drittländern für bestimmte Produkte oder das Setzen neuer Nachhaltigkeitsstandards, erfüllen. Im Fokus stehen dabei aktuell vor allem die Technologien, die das schnelle Hochfahren der CO2-freien Energieträger und CO2-freien Produktion ermöglichen. Die Kommission stuft derzeit acht Technologien als relevant ein und zwar die Solar- und Windenergie, Wärmepumpen, Technologien für grünen Wasserstoff sowie für den Netzausbau, Energie-Speichertechnologien (einschließlich Batterien), Biogas sowie Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.
Für ausgewiesene “strategische europäische Klimaindustrieprojekte” soll das Genehmigungsverfahren künftig nicht länger als neun Monate dauern, wenn es sich um Fabriken handelt, die eine jährliche Produktionsleistung von bis zu 1 Gigawatt (GW) haben, und zwölf Monate für diejenigen, die eine Produktionsleistung über 1 GW pro Jahr aufweisen. Wird innerhalb dieser Fristen keine Entscheidung getroffen, soll das Projekt als genehmigt gelten, es sei denn, eine Umweltverträglichkeitsprüfung steht noch aus.
Um die Effizienz und Transparenz der nationalen Genehmigungsverfahren zu erhöhen, ist im Net-Zero Industry Act die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Projektträger auf Ebene der Mitgliedstaaten vorgesehen. Diese One-Stop-Shops werden das gesamte Genehmigungsverfahren koordinieren und innerhalb der geltenden Fristen eine umfassende Entscheidung treffen.
Darüber hinaus schlägt die Kommission Maßnahmen zur Förderung der Innovation für eine bessere Qualifizierung und zur Koordination der Umsetzung vor. Der Vorschlag sieht vor, dass die Mitgliedstaaten zur Förderung von Innovationen spezielle Regulierungssysteme einführen können, die die Entwicklung, Erprobung und Validierung innovativer Netto-Null-Technologien vor deren Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme ermöglichen (Net-Zero-Sandkästen). Da die Stärkung der industriellen Produktion von Schlüsselprodukten der Netto-Null-Technologie ohne eine große Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte nicht möglich ist, regt die Kommission an, die Einrichtung spezialisierter europäischer Net-Zero-Industrieakademien zu unterstützen, die Aus- und Weiterbildungsprogramme in den Mitgliedstaaten anbieten. Bis Dezember 2024 und danach alle zwei Jahre müssen die Mitgliedstaaten prüfen, ob die Lernprogramme der Net-Zero-Akademien den reglementierten Berufen gleichwertig sind und, falls ja, die Anerkennung erleichtern. Eine spezielle Plattform, die Net-Zero Europe Plattform, wird die Einrichtung der Akademien, die Mobilität von Fachkräften und den Abgleich von Fähigkeiten und Arbeitsplätzen unterstützen.
Um die Einführung von erneuerbarem Wasserstoff innerhalb der EU weiter zu unterstützen, hat die Kommission auch ihre Vorschläge zur Europäischen Wasserstoffbank konkretisiert. Im Herbst 2023 wird im Rahmen des Innovationsfonds die erste Pilotauktion zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff durchgeführt. Ausgewählte Projekte erhalten einen Zuschuss in Form einer festen Prämie pro Kilogramm produzierten Wasserstoffs für eine Betriebsdauer von maximal zehn Jahren. (UV)